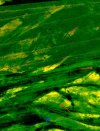Dagegen habe ich mich gar nicht ausgesprochen. Lediglich gegen die Festlegung auf einen spezifischen Stamm. Man kann wohl davon ausgehen, dass zunächst eine Werkstatt diesen Fibeltyp hergestellt hat und der sich entweder ausgebreitet hat auf mehrere Werkstätten.Nein, die Herkunft ist klar in Mitteldeutschland.
App installieren
So wird die App in iOS installiert
Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
Anmerkung: Diese Funktion ist in einigen Browsern möglicherweise nicht verfügbar.
Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Sachsen-Anhalt - römische Lager, Funde, Interessantes
- Ersteller BR110
- Erstellt am
Hermundure
Aktives Mitglied
Nun, bisher gibt es nur eine (nachweisliche) Werkstatt - die zwischen Saale und Elster bei Schkölen/Räpitz. Interessant finde ich auch das für die Hohe Kaiserzeit die Elbe als „Alba“ in den schriftlichen Zeugnissen auftaucht (Klaus-Peter Johne - Die Römer an der Elbe).
Dazu darf ich zitieren:Interessant finde ich auch das für die Hohe Kaiserzeit die Elbe als „Alba“ in den schriftlichen Zeugnissen auftaucht (Klaus-Peter Johne).
Du meinst die Stelle in der Historia Augusta:
"His gestis cum ingenti exercitu Gallias petiit, quae omnes occiso Postumo turbatae fuerant, interfecto Aureliano a Germanis possessae. tanta autem illic proelia et tam feliciter gessit, ut a barbaris sexaginta per Gallias nobilissimas reciperet civitates, praedam deinde omnem, qua illi praeter divitias etiam efferebantur ad gloriam. et cum iam in nostra ripa, immo per omnes Gallias, securi vagarentur, caesis prope quadringentis milibus, qui Romanum occupaverant solum, reliquos ultra Nicrum fluvium et Albam removit. tantum his praedae barbaricae tulit quantum ipsi Romanis abstulerant. contra urbes Romanas castra in solo barbarico posuit atque illic milites collocavit."
An diese Stelle sind zwei Fragen zu stellen:
1. Kann man dem Autor hier trauen?
2. Was ist mit "Alba" gemeint?
1. Die Informationen der Historia Augusta für Probus sind mit Vorsicht zu genießen. Mitunter widerspricht sich der Autor selber, mitunter hat er belegte Ereignisse nachweislich falsch zugeordnet. An dieser Stelle behauptet der Autor, Probus habe 400.000 Gemanen niedergemacht, die "römischen Boden besetzt hatten". Welche Glaubwürdigkeit verdienen solche Angaben?
2. Der "Nicer" wird hier als Fluss bezeichnet, bei der "Alba" fehlt eine solche Bezeichnung. Ist hier überhaupt ein Fluss gemeint? Gerald Kreucher* stellt zwei Möglichkeiten vor: Einiges spricht von der Identifizierung mit der Schwäbischen Alb. Oder aber der Autor der Historia Augusta hat sich hier ein Wortspiel mit "niger" (schwarz) und "alba" (weiß) geleistet.
Die Chronologie der Ereignisse des Feldzugs gegen Alemannen und Franken rekonstruiert Kreucher folgendermaßen:
- Am 5. Mai 277 befand sich Probus noch in Sirmium (heute Sremska Mitrovica, serbische Vojvodina)
- Das Heer könnte Mitte Mai von Sirmium oder Siscia aus aufgebrochen sein und wäre dann frühestens Ende August in Zentralgallien (Lugdunum) gewesen sein.
- Nachdem sich das Heer aufgeteilt hatte, um die gallischen Städte von den germanischen Eindringlingen zu befreien, könnte Probus den oberen Rhein bei Cambete (Kembs) Ende September/Anfang Oktober erreicht worden sein:
"Das fortschreitende Jahr mochte noch für ein Übersetzen über den Rhein ausreichen, um den Allemannen eine Lektion zu erteilen.
Allerdings kann von einem in der Vita (13,7) berichteten Vorgehen über Niger und Alba keine Rede sein."
Ich halte es für denkbar, dass römische Truppen zumindest im Mündungsbereich des Neckar und der Alb (zwei Schwarzwaldflüsse, die Obere und die Untere Alb, hießen tatsächlich Alba) im Herbst 277 operiert haben. Ob der Autor der Historia Augusta von solchen Details Kenntnis hatte, möchte ich allerdings bezweifeln.
* Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit (= Historia. Einzelschriften; Heft 174), Stuttgart 2003
Johne interpretiert das ein wenig anders als Sepiola, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten in den Überlegungen (Wortspiel schwarz-weiß):
"Allein die Deutung 'Neckar und Elbe' passt zu der Schilderung der Probusvita mit ihren anachronistischen Eroberungsplänen. [...] Die Passage verbindet spätantikes Wunschdenkenaus der Zeit um 400 mit nicht mehr vorhandenen Kenntnissen der wirklichen geographischen Verhältnisse. [...] Wie weit es von dort bis zur Elbe ist, weiß der Biograph des Probus ebenso wenig, wie Herodian, der Commodus und Maximinus Thrax Feldzüge von der Donau bis an den nördlichen Ozean unterstellt. Die Unsicherheit wird durch die vielleicht beabsichtigte doppeldeutige Aussage der Stelle ultra Nigrum fluvium et Albium 'über den schwarzen und weißen Fluß', über Neckar und Elbe noch unterstrichen."
Sprich: Johne glaubt zwar, dass in der HA bzgl. Probus von der Elbe die Rede sei, aber er wundert sich schon ein wenig über diesen Fehler des Biographen des Probus, der keine Ahnung von Geographie hatte bzw. panegyrisch die Leistungen des Probus überhöhte. Sepiolas Deutungen (es handele sich um einen der beiden Flüsse entsprechenden Namens zwischen Rhein und Neckar bzw. evtl. gar nicht um einen Fluss) haben einiges für sich. Das Geschehen hätte sich dann entweder westlich des Neckar oder südwestlich des Neckar abgespielt.
Zuletzt bearbeitet:
Hermundure
Aktives Mitglied
Mit dem Auffinden des Schlachtfeldes am Harzhorn aus der Zeit des Maximinus Thrax 235 n. Chr. waren Historiker, wie auch Archäologen, gezwungen umzudenken. Das das bisweilen dem Ein oder Anderen schwer fällt ist weder mein Problem, noch kann die Befundlage etwas dafür. Wenn dann noch ein riesiges Lager wie bei Calbe auf Grund der Funde auf den Anfang des 3. Jh. n. Chr. verweist, dann sollte man spätestens jetzt umdenken. Das römische Heer war in der Hohen Kaiserzeit wesentlich mobiler als zu Zeiten des frühen Prinzipats. Vor allem die Entwicklung mobiler und vor allem leichteren Fernwaffen (Armbrüste), Speerschleuder (mit Lederschlaufe mittig angebracht) brachten die Römer wieder auf die Erfolgsstraße. Die kleinen Vierkantbolzen wurden erstmalig am Harzhorn entdeckt (M. Geschwinde). Das Pilum war zwar vereinzelt noch in Gebrauch, jedoch schon ein Auslaufmodell, da man auch Teile von dessen viel leichteren Nachfolger, dem Spiculum, am Harzhorn fand. Ein Umdenken der Bewaffnung zu Zeiten der Severer war das Ergebnis aus den verheerenden Verlusten der schweren römischen Infanterie gegen die Markomannen und Quaden an der Donaufront unter Marcus Aurelius.
Sepiola
Aktives Mitglied
Johne interpretiert das ein wenig anders als Sepiola, aber es gibt auch Gemeinsamkeiten in den Überlegungen (Wortspiel schwarz-weiß):
"Allein die Deutung 'Neckar und Elbe' passt zu der Schilderung der Probusvita mit ihren anachronistischen Eroberungsplänen. [...] Die Passage verbindet spätantikes Wunschdenkenaus der Zeit um 400 mit nicht mehr vorhandenen Kenntnissen der wirklichen geographischen Verhältnisse. [...] Wie weit es von dort bis zur Elbe ist, weiß der Biograph des Probus ebenso wenig, wie Herodian, der Commodus und Maximinus Thrax Feldzüge von der Donau bis an den nördlichen Ozean unterstellt. Die Unsicherheit wird durch die vielleicht beabsichtigte doppeldeutige Aussage der Stelle ultra Nigrum fluvium et Albium 'über den schwarzen und weißen Fluß', über Neckar und Elbe noch unterstrichen."
Sprich: Johne glaubt zwar, dass in der HA bzgl. Probus von der Elbe die Rede sei, aber er wundert sich schon ein wenig über diesen Fehler des Biographen des Probus, der keine Ahnung von Geographie hatte bzw. panegyrisch die Leistungen des Probus überhöhte. Sepiolas Deutungen (es handele sich um einen der beiden Flüsse entsprechenden Namens zwischen Rhein und Neckar bzw. evtl. gar nicht um einen Fluss) haben einiges für sich. Das Geschehen hätte sich dann entweder westlich des Neckar oder südwestlich des Neckar abgespielt.
Ich habe eigentlich nicht die These verfochten, mit der Alba habe der Autor der Historia Augusta die Obere oder Untere Alb im Sinn gehabt. Mir geht es darum, dass die Frage, wie die Alba in den Text gerutscht ist, nicht entschieden ist; gelesen habe ich dazu:
- Johannes Straub, Alba = Elbe oder Alb? In: Bonner Jahrbücher 155/156 (1955/56)
- Hans Widmann, Der Name der Schwäbischen Alb, Lahr 1957 (Sonderdruck aus: Alemannisches Jahrbuch)
- Gerald Kreucher, Der Kaiser Marcus Aurelius Probus und seine Zeit, Stuttgart 2003
- Klaus-Peter Johne, Die Römer an der Elbe, Berlin 2006
Straub war der Ansicht, mit der Alba sei in jedem Fall die Elbe gemeint. Johne hat sich dieser Meinung angeschlossen, Widmann und Kreucher nicht.
Hier nochmal die Stelle in der Historia Augusta, sie bezieht sich auf einen Feldzug des Kaisers Probus anno 277:
"His gestis cum ingenti exercitu Gallias petiit, quae omnes occiso Postumo turbatae fuerant, interfecto Aureliano a Germanis possessae. tanta autem illic proelia et tam feliciter gessit, ut a barbaris sexaginta per Gallias nobilissimas reciperet civitates, praedam deinde omnem, qua illi praeter divitias etiam efferebantur ad gloriam. et cum iam in nostra ripa, immo per omnes Gallias, securi vagarentur, caesis prope quadringentis milibus, qui Romanum occupaverant solum, reliquos ultra Nicrum fluvium et Albam removit. tantum his praedae barbaricae tulit quantum ipsi Romanis abstulerant. contra urbes Romanas castra in solo barbarico posuit atque illic milites collocavit."
Da @Hermundure nur das Wort "Alba" herausgreift, sich auf die einseitige Interpretation versteift und alles andere, was den Quellen zu entnehmen ist, mit bemerkenswerter Sturheit ignoriert, möchte ich auf zwei Dinge hinweisen:
1. Der Autor spricht nicht nur von der "Alba" (was immer damit gemeint ist), sondern vom Neckar (Nicer bzw. Niger), das heißt im Klartext: Kaiser Probus konnte sich zumindest rühmen, die Barbaren, die bereits Gallien besetzt hatte, bis zum Neckar zurückgetrieben zu haben.
Bis zum Neckar! Wenn das eine erwähnenswerte Großtat war, dann kann die "Alba" entweder ernst genommen werden (dann muss sie zwingend in Neckarnähe gesucht werden) oder eben nicht.
2. Es ist sogar zweifelhaft, ob Probus überhaupt so weit gekommen ist, die Zeit reichte im Herbst 277 für einen größeren Feldzug nicht aus:
Kreucher, S. 139:
Probus könnte den oberen Rhein nach einem Marsch von etwa 400 km von Lyon aus in etwa drei Wochen erreicht haben. Da von einem - wenn auch nur kurzen - Aufenthalt in der Stadt auszugehen ist, könnte der Rhein bei Cambete (Kembs) Ende September/Anfang Oktober erreicht worden sein. Das fortschreitende Jahr mochte noch für ein Übersetzen über den Rhein ausreichen, um den Alemannen eine Lektion zu erteilen.
Allerdings kann von einem in der Vita (13,7) berichteten Vorgehen über Niger und Alba keine Rede sein. Diese Bezeichnungen wurden von Straub mit den Flüssen Neckar und Elbe identifiziert. Die angebliche Zurückdrängung der Feinde hinter Neckar und Elbe sei als summarische Formel aufzufassen, was auch durch den fiktiven Brief des Probus an den Senat (Pr. 15, 1-7) bestätigt würde. Wenn auch einiges für die alte Identifizierung mit dem Neckar und der (Rauhen / Schwäbischen) Alb spricht, so ist die Möglichkeit eines Wortspiels mit den Begriffen "Schwarz" und "Weiß", das Paschoud an dieser Stelle sieht, gleichermaßen wahrscheinlich. Eine beschränkte Operation im südlichen Teil des ehemaligen Dekumatlandes ist jedoch nicht ausgeschlossen. Ob nicht tatsächlich der Neckar erreicht wurde, läßt sich nicht mehr feststellen. Von einer dauerhaften Rückeroberung des Gebietes kann dagegen in keinem Fall ausgegangen werden.
Mit dem Auffinden des Schlachtfeldes am Harzhorn aus der Zeit des Maximinus Thrax 235 n. Chr. waren Historiker, wie auch Archäologen, gezwungen umzudenken. Das das bisweilen dem Ein oder Anderen schwer fällt ist weder mein Problem, noch kann die Befundlage etwas dafür. Wenn dann noch ein riesiges Lager wie bei Calbe auf Grund der Funde auf den Anfang des 3. Jh. n. Chr. verweist, dann sollte man spätestens jetzt umdenken.
Ich habe eigentlich kein Problem damit, einen römischen Feldzug Anfang des 3. Jahrhunderts bis zur Saale für möglich zu halten. (Dazu hätte ich dann allerdings gern handfeste Belege, das Schwert von Töppel zählt definitiv nicht dazu.)
Ich habe nur etwas dagegen, die Quellen umzuschreiben, indem man 99% der Quellenangaben völlig ignoriert und stattdessen zwei oder drei der unsichersten Angaben herausfischt, um daraus Statements wie "Der Feldzug zu den 'Elbbewohnern' im Jahr 213 n. Chr. ist ja auch historisch belegt" zu basteln.
Wenn wir die Quellen ernst nehmen, waren weder Caracalla anno 213 noch Probus anno 277 an der Elbe.
Zuletzt bearbeitet:
Sepiola
Aktives Mitglied
Dazu hatte ich die Frage gestellt:Domitian ist ja der Damnatio verfallen. Sein Chattenfeldzug wird ja mittlerweile wissenschaftlich kontrovers diskutiert.
Was genau wird kontrovers diskutiert, und seit wann?
Die Tatsache des Feldzugs und sein Ergebnis dürften doch nicht umstritten sein?
Spatenpaulus
Mitglied
Zumindest beim großen Feldlager bei Calbe/Saale (mit Titulum), das konnte ich in Erfahrung bringen, verdichten sich die Anzeichen auf Grund der Prospektionsfunde (Münzen und andere metallische Kleinteile) auf die Anwesenheit römischer Truppen unter Kaiser Caracalla. Der Feldzug zu den „Elbbewohnern“ im Jahr 213 n. Chr. ist ja auch historisch belegt (Cassius Dio - Albanoi). Dagegen warten die beiden Lager in Aken noch auf ihre Bestimmung.
Caracalla wäre die letzte Möglichkeit, die ich in Betracht gezogen hätte. Ich hätte tatsächlich eher an Drusus oder Tiberius gedacht. Im entferntesten Sinne noch an Maximinus Thrax, obwohl dieser meiner Meinung nach vermutlich nicht die Elbe erreicht hat.
Aber das man seitens des LDA nunmehr Truppen von Caracalla im Verdacht hat, ist schon bemerkenswert.
Interessant in diesem Zusammenhang ist, dass in der Altmark häufige Münzfunde des Caracalla und seines unmittelbaren Vorgängers im Amt gemacht werden. Bisher ging die Forschung davon aus, dass diese Münzen überwiegend Raubgut plündernder Germanen gewesen wären. Vielleicht stehen diese Münzfunde im Zusammenhang mit der Anwesenheit römischer Heeresmacht in der Elbe-Saale-Region.
Pardela_cenicienta
Aktives Mitglied
Siehst Du, @Stefan70, dann hast Du gute Quellenkritik betrieben und bist schlauer als das Internet. "¡Ad raíces!", würde @El Quijote sagen.
Zu den Wurzeln! Aber bis in die Wurzeltiefe der römischen Gräben sind die Schäufelchen und Bagger der Archäologen in Calbe (Saale) erst zum Teil gekommen: @Hermundure sprach von vorläufigen Befunden und bisherigen Prospektionsergebnissen.
Zu den Wurzeln! Aber bis in die Wurzeltiefe der römischen Gräben sind die Schäufelchen und Bagger der Archäologen in Calbe (Saale) erst zum Teil gekommen: @Hermundure sprach von vorläufigen Befunden und bisherigen Prospektionsergebnissen.
Zuletzt bearbeitet:
Eigentlich sage ich immer ad fontes - zu den Quellen!.Siehst Du, @Stefan70, dann hast Du gute Quellenkritik betrieben und bist schlauer als das Internet. "¡Ad raíces!", würde @El Quijote sagen.
Zu den Wurzeln! Aber bis in die Wurzeltiefe der römischen Gräben sind die Schäufelchen und Bagger der Archäologen in Calbe (Saale) erst zum Teil gekommen: @Hermundure sprach von vorläufigen Befunden und bisherigen Prospektionsergebnissen.
Hallo an alle!
Ich wollte Euch mal wieder eine interessante Grabenkonstellation zeigen, die ich im Raum Magdeburg gefunden habe.
Man kann Teile von 3 Seiten erkennen. Der nördliche Graben ist aufgrund des Geländes bzw. eventuellen späteren Eingriffen nicht mehr identifizierbar.
Im bräunlichen Bild sieht man die südwestlichen und südöstlichen Gräben inklusive einer möglichen Lagerecke. Diese ist exakt nach Süden ausgerichtet.
Im grünlichen Bild ist noch einmal ein Teil des südöstlichen Grabens und ein Teil vom nordöstlichen Graben inklusive Lagerecke zu sehen.
In beiden Bildern hab ich einen möglichen Lagereingang ( bzw. einen Teil davon) im südöstlichen Graben mit blau gekennzeichnet. Dieser wäre fast in der Mitte.
Die eine (Lager) Ecke ist im 90 Grad Winkel und die andere hat einen leicht größeren Winkel.
Ganz kurz noch zur Größe. Es wäre wesentlich kleiner als die Lager an der Saale und an der Elbe.
Von den Abmessungen her wäre es ca. 15 Hektar bis maximal/eventuell 17 Hektar groß.
Südöstlicher Graben ca. 350m +/- 15m
Nordöstlicher Graben vermutlich ca. 450m +/- 15m
Ich bin gespannt, wie Ihr das einschätzt.
Einen guten Wochenstart wünsche ich Euch.
Steffen
Ich wollte Euch mal wieder eine interessante Grabenkonstellation zeigen, die ich im Raum Magdeburg gefunden habe.
Man kann Teile von 3 Seiten erkennen. Der nördliche Graben ist aufgrund des Geländes bzw. eventuellen späteren Eingriffen nicht mehr identifizierbar.
Im bräunlichen Bild sieht man die südwestlichen und südöstlichen Gräben inklusive einer möglichen Lagerecke. Diese ist exakt nach Süden ausgerichtet.
Im grünlichen Bild ist noch einmal ein Teil des südöstlichen Grabens und ein Teil vom nordöstlichen Graben inklusive Lagerecke zu sehen.
In beiden Bildern hab ich einen möglichen Lagereingang ( bzw. einen Teil davon) im südöstlichen Graben mit blau gekennzeichnet. Dieser wäre fast in der Mitte.
Die eine (Lager) Ecke ist im 90 Grad Winkel und die andere hat einen leicht größeren Winkel.
Ganz kurz noch zur Größe. Es wäre wesentlich kleiner als die Lager an der Saale und an der Elbe.
Von den Abmessungen her wäre es ca. 15 Hektar bis maximal/eventuell 17 Hektar groß.
Südöstlicher Graben ca. 350m +/- 15m
Nordöstlicher Graben vermutlich ca. 450m +/- 15m
Ich bin gespannt, wie Ihr das einschätzt.
Einen guten Wochenstart wünsche ich Euch.
Steffen
Anhänge
Spatenpaulus
Mitglied
Hallo an alle!
Ich wollte Euch mal wieder eine interessante Grabenkonstellation zeigen, die ich im Raum Magdeburg gefunden habe.
Man kann Teile von 3 Seiten erkennen. Der nördliche Graben ist aufgrund des Geländes bzw. eventuellen späteren Eingriffen nicht mehr identifizierbar.
Im bräunlichen Bild sieht man die südwestlichen und südöstlichen Gräben inklusive einer möglichen Lagerecke. Diese ist exakt nach Süden ausgerichtet.
Im grünlichen Bild ist noch einmal ein Teil des südöstlichen Grabens und ein Teil vom nordöstlichen Graben inklusive Lagerecke zu sehen.
In beiden Bildern hab ich einen möglichen Lagereingang ( bzw. einen Teil davon) im südöstlichen Graben mit blau gekennzeichnet. Dieser wäre fast in der Mitte.
Die eine (Lager) Ecke ist im 90 Grad Winkel und die andere hat einen leicht größeren Winkel.
Ganz kurz noch zur Größe. Es wäre wesentlich kleiner als die Lager an der Saale und an der Elbe.
Von den Abmessungen her wäre es ca. 15 Hektar bis maximal/eventuell 17 Hektar groß.
Südöstlicher Graben ca. 350m +/- 15m
Nordöstlicher Graben vermutlich ca. 450m +/- 15m
Ich bin gespannt, wie Ihr das einschätzt.
Einen guten Wochenstart wünsche ich Euch.
Steffen
Hallo Steffen,
das könnte grundsätzlich ein möglicher Lagergraben sein. Allerdings können es auch in Unkenntnis der sonstigen, sich in der Nähe befindlichen, Bodenanomalien auch Starkstromleitungen, eine Gasleitung oder sonstige landwirtschaftlich bedingte Strukturen sein. Wenn du willst, schick mir eine PN und ich gucke morgen mal in die Luftbilddatenbank unserer Dienststelle. Mit etwas Glück kann ich deine Vermutung stützen, oder eben auch entkräften.
Hast du die Struktur schon mit dem passenden Messtischblatt verglichen? Mit diesen kann man eine erste Vorprüfung vornehmen.
VG
Rene
dekumatland
Aktives Mitglied
------- kurze Unterbrechung, Pardon ----
@Spatenpaulus
---- kurze Unterbrechung fertig ---
@Spatenpaulus
finden sich da auch Luftbilddaten zu neuzeitlichen Festungsanlagen?die Luftbilddatenbank unserer Dienststelle.
---- kurze Unterbrechung fertig ---
Spatenpaulus
Mitglied
Das sind Ganz normale Satellitenbilder, die sich aber von den Aufnahmedaten von Google-Earth unterscheiden. D.h. es wurden teilweise Aufnahmen im Mai 2023 gemacht, die Bodenanomalien besonders gut sichtbar machen. Das bedeutet aber nicht, dass ganz Deutschland gleichmäßig gut abgebildet ist. Der Raum südlich Magdeburg ist z.B. besonders gut getroffen. Neben Kreisgräben, Grabenwerken, Urnenfriedhöfen, Wüstungen, Grubenhäusern kann man auch das römische Marschlager bei Calbe sehr gut erkennen. Aber nur auf den Feldern, die zum Zeitpunkt der Aufnahme mit Getreide bestellt waren. Das mutmaßlich römische Marschlager bei Aken kann man z.B. nicht erkennen.------- kurze Unterbrechung, Pardon ----
@Spatenpaulus
finden sich da auch Luftbilddaten zu neuzeitlichen Festungsanlagen?
---- kurze Unterbrechung fertig ---
Darüber hinaus besteht die Möglichkeit durch "Schummerung" die Strukturen in Wäldern sichtbar zu machen.
Neben Bombentrichtern können so auch alte Stellungssysteme, Hohlwege und sonstige Anomalien erkannt werden.
dekumatland
Aktives Mitglied
@flavius-sterius gibt es Neuigkeiten zu Hedemünden, oder zeigt der Wikipedia Artikel den letzten Stand (also mindestens 10 Jahre alt)?Die Militäranlage von Hedemünden - bei welchem sich die Fachwelt über deren Einordnung zerstritten hat - ist
Ich war im Sommer vor 3 Jahren dort: es machte keinen gepflegten und auch keinen sonderlich frequentierten Eindruck.
Das ist eben das Problem: Man hat keine Geschichte dazu, die man erzählen kann. Archäologie braucht Menschen (in Geschichten), damit sie griffig wird. Archäologie ist ja letztlich auch eine anthropologische Wissenschaft, der Mensch steht im Zentrum, nicht das Artefakt. Der Mensch, der es hergestellt hat, der Mensch, der es benutzt hat.@flavius-sterius gibt es Neuigkeiten zu Hedemünden, oder zeigt der Wikipedia Artikel den letzten Stand (also mindestens 10 Jahre alt)?
Ich war im Sommer vor 3 Jahren dort: es machte keinen gepflegten und auch keinen sonderlich frequentierten Eindruck.
flavius-sterius
Aktives Mitglied
Ich bin da räumlich weit von entfernt und die Medien, die ich regelmäßig nutzen, bringen zu Hedemünden auch nichts mehr.@flavius-sterius gibt es Neuigkeiten zu Hedemünden, oder zeigt der Wikipedia Artikel den letzten Stand (also mindestens 10 Jahre alt)?
Ich war im Sommer vor 3 Jahren dort: es machte keinen gepflegten und auch keinen sonderlich frequentierten Eindruck.
Mittelalterlager
Aktives Mitglied
Ich habe auf der Seite des Landesdenkmalamtes Sachsen Anhalt bisher nix zu Calbe oder anderen eventuellen römischen Lagern in der Nähe gefunden. Suche ich da falsch oder ist da noch nichts Relevantes gefunden worden????!!!
Es scheint noch nichts veröffentlicht zu sein. Aber der Fairness halber:Ich habe auf der Seite des Landesdenkmalamtes Sachsen Anhalt bisher nix zu Calbe oder anderen eventuellen römischen Lagern in der Nähe gefunden. Suche ich da falsch oder ist da noch nichts Relevantes gefunden worden????!!!
Notgrabungen werden oft nicht besonders schnell wissenschaftlich ausgewertet (manchmal schon, bei besonderen Funden/Befunden), da bei Notgrabungen der wissenschaftliche Teil (jenseits der Dokumentation) nicht finanziert ist. Oft lagern die Aufzeichnungen und Funde Jahrzehnte unbearbeitet in den Magazinen/Archiven. Und BA- oder MA-Arbeiten werden i.d.R. ja auch nicht veröffentlicht. Erst bei Promotionen gibt es eine Veröffentlichungspflicht (erst nach Veröffentlichung der Dissertation wird man promoviert, egal wie erfolgreich die Prüfung war).
Eine relativ zügige Bearbeitung von Funden und Befunden ist bei Drittmittel-finanzierten Grabungen zu erwarten, aber auch da kann es von der Grabung bis zur Veröffentlichung mehrere Jahre dauern. Oft haben Archäologen ja auch mehrere Projekte am Laufen.
Zu einer Grabung 2026 wird mit Glück 2029 eine Auswertung publiziert.
Oft gibt es Vorabberichte. In Bayern haben wir das "Archäologische Jahr in Bayern" als einmal jährlich erscheinende Zeitschrift (aber wirklich Vorabberichte, das ist noch lange keine Publikation). Ich weiß nicht, ob es etwas Ähnliches als jährliche oder monatliche Zeitschrift in Sachsen-Anhalt gibt, aber falls ja, wäre es da sehr wahrscheinlich zumindest schonmal angeschnitten.
Was die wissenschaftliche Auswertung/Aufarbeitung und Publikation angeht, hat @El Quijote ja schon alles gesagt - es ist unsicher und es dauert.
Unterschiedlich lange, aber nach Grabungsschluss 2-3 Jahre ist normal das Minimum. Ich arbeite gerade an der Publikation einer Forschungsgrabung, die dürfte jetzt dieses Jahr endlich rauskommen; Grabungsschluss war 2022. Aber auch bei Forschungsgrabungen gilt dasselbe wie bei Notgrabungen. Wenn es spannende Einzelfunde oder -befunde gibt, bietet sich oft ein Vorabbericht in einem Zeitschriftenformat an.
Was die wissenschaftliche Auswertung/Aufarbeitung und Publikation angeht, hat @El Quijote ja schon alles gesagt - es ist unsicher und es dauert.
Unterschiedlich lange, aber nach Grabungsschluss 2-3 Jahre ist normal das Minimum. Ich arbeite gerade an der Publikation einer Forschungsgrabung, die dürfte jetzt dieses Jahr endlich rauskommen; Grabungsschluss war 2022. Aber auch bei Forschungsgrabungen gilt dasselbe wie bei Notgrabungen. Wenn es spannende Einzelfunde oder -befunde gibt, bietet sich oft ein Vorabbericht in einem Zeitschriftenformat an.